| Bewusst-Sein | Sprachliches Denken | Sprachliches Gedächtnis | Sinn |
| Lernen | Wissen | Intelligenz | Gefühle |
George Herbert Mead
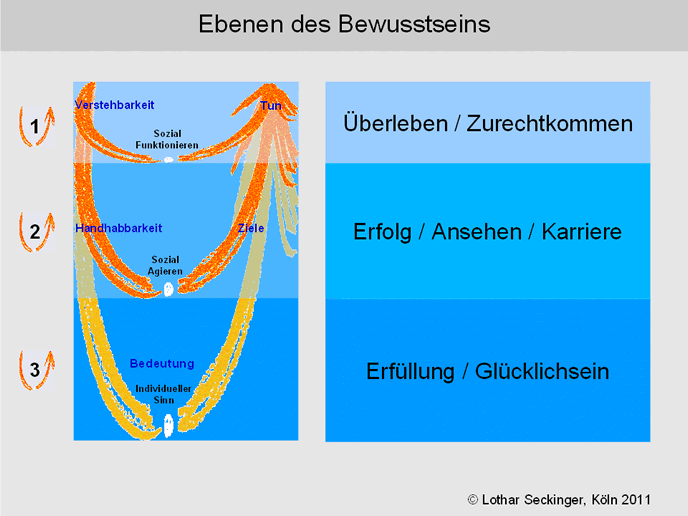
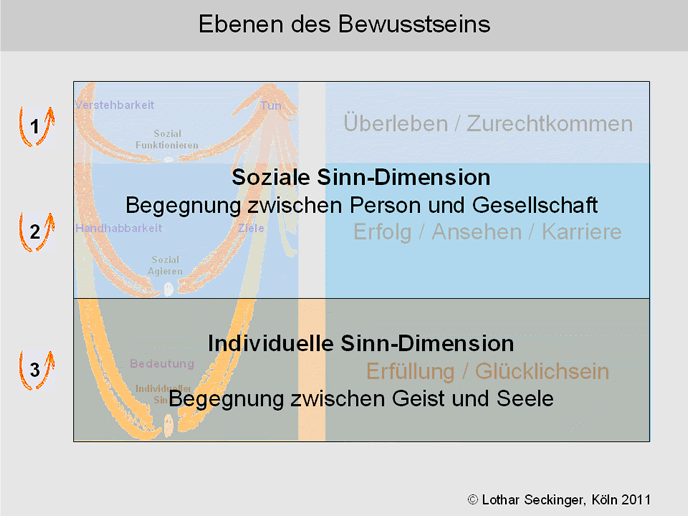
Gibt es ein Bewusstsein ohne Sprache? Was könnte das sein? Und was ist und auf was bezieht sich dann das "sprachliche" Bewusstsein?
Die Aussage "bei Bewusstsein sein" ist problematisch, da sie den einfachen Zustand des "Wachseins" im Gegensatz zum "Schlaf" oder "Koma" in der Dimension des Seins mit dem "sich in der Dimension der Sprache orientieren können" vermischt. Nichtsprachliche Wesen sind wach oder schlafen oder sind im Koma oder in anderen rein körperlichen Zuständen. Im wachen Zustand können sie sich im belebten und unbelebten Kosmos orientieren und anschlussfähig bewegen bzw. agieren sowie reagieren. Können sie das nicht, sind sie schnell dem Tod geweiht. Mit Bewusstsein hat das jedoch nichts zu tun.
===> Aufmerksamkeit versus Bewusstsein!!!!
Menschen dagegen müssen sich zusätzlich in der Dimension der Sprache orientieren können, um "sich ihrer bewusst" zu sein. Sie müssen sich nicht nur im Raum, sondern auch in den sprachlichen Konstrukten Zeit und den sprachlichen Sinnstrukturen ihrer sozialen Sprachsysteme orientieren können, somit Datum, Uhrzeit, ihren Namen, ihr Geschlecht, ihre Familie, ihre Nationalität, den sprachlichen Kontext ihrer gegewärtigen Situation identifizieren und viele weitere sprachlich kodierte Bedeutungszusammenhänge erfassen, um sich "sinnvoll" zu verhalten und in der sprachlich-sozialen Dimension anschlussfähig zu sein. Können sie das nicht, sind sie "verrückt". Sie "fallen" aus ihrem "sprachlichen" Rahmen.
Sich seiner bewusst sein, mithin Bewusstsein, kann somit nur in dem sprachlichen Kontext intersubjektiv vereinbarter Bedeutungszuweisungen entstehen, in dem ein "ich" und ein "du" in einem ebenfalls sprachlich konstruierten Kontext vorkommen und über das Medium Sprache gegenseitig aufeinander abgestimmte Verhaltenskoordination erfolgt.
Trennen wir den Begriff Bewusstsein folglich einmal in bewusst sein. Was also bedeutet es, bewusst zu sein? Impliziert das nicht zwingend, eine Vorstellung vom eigenen Sein zu haben? Was aber ist eine Vorstellung vom eigenen Sein?
Als ein Hinweis auf das Vorhandensein von Bewusstsein oder sogar Selbstbewusstsein wird immer wieder der Spiegeltest erwähnt. Ein Lebewesen ist dabei zunächst dazu fähig, sich im eigenen Spiegelbild zu erkennen und darin nicht etwa einen Artgenossen zu vermuten. Darüber hinaus fällt ihm ein unbemerkt angebrachtes Merkmal - wie z.B. ein Farbfleck auf der Stirn - sofort als ungewöhnlich und störend auf, weshalb es prompt versucht, das Mal vom eigenen Körper zu entfernen.
Damit sich ein Lebewesen aber selbst in einem Siegel erkennen kann, muss es einerseits ausreichende kognitive Kompetenzen besitzen, um eine relativ präzise innere Repräsentation seines eigenen körperlichen Äußeren entwickeln zu können. Andererseits müssen hinreichend viele "spiegelbildliche Selbstbegegnungen" stattfinden, damit das eigene Äußere über die Entdeckung der Parallelität zwischen der Wahrnehmung der eigenen körperlichen Dynamik und der Erscheinung im Spiegel identifiziert werden kann. Solche Gelegenheiten sind in der Natur jedoch höchst selten vorhanden, da natürliche Spiegel kaum vorkommen. Außerdem, was ist mit dem Erkennen des eigenen Äußeren in einem Spiegel wirklich gewonnen und welchen evolutionären Vorteil hätte ein sprachloses Lebewesen dadurch errungen?
Stellen wir die Frage deshalb einmal anders: was kann die Entdeckung eines kausalen Zusammenhangs zwischen den eigenen körperlichen Zustandsempfindungen und dem wahrgenommenen Verhalten des Wesens im Spiegel in einem sprachlosen Wesen auslösen? Es kann ja nicht daraus schließen, das bin ich, denn das würde Sprache voraussetzen. Was aber könnte es dann "denken" oder darin "erkennen"?
Bei der allerersten spiegelbildlichen Begegnung wird das Wesen im Spiegel unbestreitbar als Geschöpf der eigenen Art identifiziert, denn davon hat jede Spezies eine evolutionär geformte, klare phänomenale Repräsentation entwickelt. Im ersten Moment ist dieses Wesen allerdings noch unbekannt, weshalb normalerweise eine Reaktion erfolgt, als wäre ein Zusammentreffen mit einem fremden Individuum der eigenen Art eingetreten. Das Fremdsein löst somit zunächst Unsicherheit und je nach dem Charakter des sich selbst Betrachtenden die entsprechende Mischung aus den Emotionen Furcht und Aggression aus.
Schnell wird dann erkannt, dass das Wesen im Spiegel weder riecht noch Laute ausstößt und auch ein seltsames Verhalten zeigt, das das vorhandene evolutionär entwickelte und neuronal vorgehaltene Erfahrungswissen nicht deuten kann. Die Reaktionen auf eigenes Gebaren passen nicht entsprechend komplementär in die phylogenetisch wie auch ontogenetisch erworbenen Erwartungsmuster. Kein Geruch oder Geräusch verrät dessen Geschlecht oder Gemütszustand, es lässt sich weder durch Drohgebärden beeindrucken und vertreiben, noch durch Unterwerfung beschwichtigen, noch durch Annäherung zum Spiel auffordern. Anfängliche Unsicherheit verwandelt sich deshalb normalerweise rasch in Desinteresse, da sich das eigenartige Geschöpf im Spiegel völlig unadäquat verhält. Die meisten nichtsprachlichen Lebewesen wenden sich ab und gehen weiterhin unbeeindruckt ihrer Wege.
Der Grund für ein derartiges Verhalten liegt wohl darin, dass in der freien Natur keine Spiegel vorkommen. Gelegentliche Begegnungen mit Spiegelungen in ruhigen Gewässern waren nicht dazu geeignet, entsprechende Erfahrungen mit dem eigenen Spiegelbild zu sammeln. Und selbst wenn sie stattfanden, waren sie zu unbedeutend für den täglichen Überlebenskampf, um neuronal kodiert in das stammesgeschichtliche Verhaltensrepertoire übernommen und über die Generationen hinweg tradiert zu werden.
Nur in der Obhut oder Gefangenschaft des Menschen können lebende Geschöpfe Erfahrungen mit Spiegeln machen. Im relativ ungefährlichen Lebensraum eines Käfigs können ausreichend dauerhafte und wiederholte Begegnungen mit dem eigenen Spiegelbild stattfinden. Aber selbst unter derart unnatürlich günstigen Bedingungen konnten nur wenige von Natur aus sehr neugierige und in ihrer sozialen Organisation wie auch ihren kognitiven Fähigkeiten ausreichend weit entwickelte Exemplare von Menschenaffen und Vögeln nach und nach die Entdeckung machen, dass die Situation allein durch eigenes Verhalten unter Kontrolle ist. Angst weicht mehr und mehr dem angeborenen Spieltrieb und dem damit verbundenen, ebenfalls angeborenen Wissensdrang. Über ein relationales Spiel mit dem spiegelbildlichen Gegenüber, das unter anderem Grimassenschneiden, gezieltes Gestikulieren wie auch die aufmerksame Betrachtung und Betastung von ansonsten dem Blick nicht zugänglichen Körperteilen umfassen kann, reift die Erkenntnis heran, dass die Gestalt im Spiegel immer das tut, was dem eigenen Körperempfinden entspricht. Bewegungsabläufe, Berührungen durch Hände und Füße, alles was die eigenen Körperzustände und die eigenen Tast- sowie Berührungssinne vermitteln, entsprechen dem im Spiegel Gesehenen.
Aber kann nun allein dadurch, dass ein sprachloses Lebewesen die Bewegungsabläufe seines spiegelbildlichen Gegenübers richtig deuten kann und sich anschließend so verhält, als ob es sich selbst darin erkennen würde, schon eine Vorstellung vom eigenen Selbst und darauf aufbauend vom eigenen Sein entstanden sein? Oder ist es nicht vielmehr so, dass diese Wesen schlicht die unmittelbare Parallelität zwischen den eigenen Handlungsabläufen und deren spiegelbildlicher Repräsentation erkannt haben und sich entsprechend verhalten? Der Griff nach dem Farbklecks auf der eigenen Stirn erfolgt also nicht aus einem Bewusstsein über das eigene Selbst heraus, sondern lediglich aufgrund der zuvor erkannten und erlernten spiegelbildlichen Effekte. Im Verhaltensrepertoire des sprachlosen Seins kommt ein Selbst weiterhin nicht vor. Kein sprachloses Lebewesen hat deshalb auch jemals einen Artgenossen herbeigeholt und ihm andeuten können, dass das eigene Spiegelbild es selbst und das des Anderen das Spiegelbild des Anderen sei.
Die Begegnung mit dem eigenen Spiegelbild bleibt vielmehr ein phänomenales Ereignis, das an die Präsenz des Spiegels gebunden ist. Mit dem Verschwinden des Spiegels verschwindet auch das Wesen im Spiegel, das nur dort und nirgendwo anders existiert.
Können wir nun daraus schließen, dass ohne Sprache keine Referenz zur eigenen Existenz enstehen kann und sprachlose Lebewesen existieren, ohne mental realisieren zu können, dass sie existieren, mithin Sprache eine Bedingung für ein bewusstes Sein ist?
Merlin Donald schreibt dazu in "A Mind So Rare":
The executive brain system improved its ability to monitor the state of the physical self and gained access to much more detail, so that precise attention could be paid to the body's own movement patterns. Thus the first rung into our distinctively human ladder of awareness is the physical self, a supraordinate form of body awareness, born of a need to refine action.
sowie
The cognitive core of mimesis is kinematic imagination, the ability to envision our bodies in motion.
Mit "mimesis" ist dabei die Pantomime als Kommunikationsmedium gemeint, die in den ersten Lebensphasen der Gattung Homo sicherlich dazu diente, die zunehmenden kommunikativen Anforderungen des Lebens in der Savanne bewältigen zu können. Über die Notwendigkeit, durch gezielt ausgeführtes körperliches Gebärdenspiel Information übertragen und die Gesten der anderen letztendlich auch deuten zu können, musste die intendierte Botschaft in einen kausalen Zusammenhang zu den körperlich verfügbaren Ausdrucksformen gebracht werden.
Schon in dieser Phase mussten somit körperliche Signale in einem kommunikativen Prozess in einen intersubjektiv abgestimmten Bedeutungszusammenhang gebracht und dann in ihrer Bedeutungszuweisung stabilisiert werden, um eine Übertragung von auf eine bestimmte Absicht zielende Mitteilungen zwischen den einzelnen Subjekten dauerhaft, schnell und sicher gewährleisten zu können.
Brain storming ===>
Wie aber könnte es allein durch elaborierte körperlich-symbolische Repräsentation des real-existierenden Universums zu der Erkenntnis des eigenen Selbsts und mithin der Vorstellung des Seins gekommen sein? Wie überhaupt sieht die Repräsentation des eigenen Selbsts ohne Sprache in der Pantomime und bildlich-akustischen Darstellung aus? Ist dadurch die nötige intrasubjektive Reflexion möglich, in der das eigene Selbst Gestalt annehmen und eine Kontemplation des Seins sattfinden kann?
Ich habe da meine Zweifel, vor allem, weil die Bandbreite der symbolischen Repräsentation durch die Pantomime und die bildliche Darstellung die Komplexität der wahrnehmbaren Umweltphänomene nicht ausreichend differenzieren und damit eindeutig genug erfassen kann. Damit bleibt einerseits ein intersubjektiv äußerst instabiler Interpretationsspielraum entsprechender symbolischer Repräsentation, und andererseits fehlt auch ein ausreichend nuanciertes Medium, um ein Selbst, ein "Ich" intersubjektiv, vor allem aber intrasubjektiv symbolisch-repräsentativ darzustellen.
Die Vorstellung von einem Selbst beinhaltet natürlich eine differenzierte Wahrnehmung der eigenen Körperlichkeit und der Wirkungen entsprechend körperlicher Handlungen. Aber diese bekommen ihre Bedeutung immer nur im Zusammenhang mit dem Anderen. Nur in der Kommunikation mindestens zweier Gehirne kann in deren gemeinsam konstruiertem Bedeutungszusammenhang ein Ich und ein Du entstehen. Pantomimisch ist das nun äußerst schwer!!
Wie sollte eine pantomimische oder bildliche Darstellung des eigenen Selbst nun denn aussehen? Die einfache Aussage, das bin ich, ist pantomimisch wie auch bildlich äußerst schwer darzustellen. Spiegel waren in der trockenen Savanne so gut wie nie vorhanden, was den Zugang zur eigenen Äußerlichkeit sehr erschwert haben dürfte.
Der Schlüssel, um dies zu verstehen, ist die erforderliche Intersubjektivität. Bewusstes Sein kann in keinem singulären Gehirn entstehen. Erst über die Verbindung zweier Gehirne in einem gemeinsam konstruierten Bedeutungszusammenhang wird die eigene und die Existenz des anderen "erkennbar".
Bewusstes Sein setzt eine Vorstellung vom eigenen Selbst voraus. Ohne ein Selbst ist ein individuelles Sein nicht denkbar. Im ersten Schritt zum bewussten Sein muss ein Lebewesen somit zunächst die Existenz des eigene Selbsts erfassen können. Das eigene Selbst ist nun jedoch nur dann zugänglich, wenn eine Referenz, ein Bezugspunkt besteht, der die physischen Grenzen des Seins überwinden kann.
Da die Welt nicht voller Spiegel ist, in denen wir uns ständig selbst beobachten können, bleibt nur die Sprache, in der wir über eine virtuelle Referenz unseres physischen Seins uns selbst zum Thema machen und dadurch unser Verhalten referenzieren und beobachten können.
Auf dem Weg zum bewussten Sein überwinden wir die Grenzen unserer physischen Existenz, um über eine virtuelle sprachliche Referenz Selbstbeobachtung möglich zu machen. In der rein körperlich-physischen Dimension gibt es somit kein Bewusstsein, sondern nur Sein. Der Körper ist, verhält sich in seinem Milieu, ist sich dessen jedoch nicht "bewusst". Erst in der sprachlich-virtuellen Dimension entsteht durch eine virtuelle Referenz eine Repräsentation der eigenen Existenz, über die ein bewusstes Sein in der Sprache konstruiert und als Bezugspunkt genutzt werden kann.
<=== Brain storming
Sprachliches Gedächtnis
Welche Rolle spielt ein Gedächtnis im Organisieren von Überleben? Wie unterscheiden sich, wenn überhaupt, "phänomenales" und "sprachliches" Gedächtnis?
Gibt es ein phänomenal-virtuelles Gedächtnis in der Dimension des Seins und ein sprachlich-virtuelles in der Dimension der Sprache? Ist die phänomenale Ausprägung allen lebenden Kreaturen gemein, die sprachliche dagegen nur in der Spezies Mensch vorhanden?
Inwieweit sind beide Formen des Gedächtnisses repräsentationale Rekonstruktionen vergangener Ereignisse und Erfahrungen?
Was ist also Gedächtnis und Erinnerung in der Dimension der Sprache? Wozu benötigen wir ein autobiografisches Gedächtnis, Faktengedächtnis, Bekanntheits- oder Vertrautheitsgedächtnis. Doch wohl nur, um uns unseres Platzes in den sprachlich-virtuellen Sinnkonstruktionen unserer Spezies zu versichern und damit darin anschlussfähig, also nicht verrückt zu sein. Anatomisch schlecht dazu gerüstet, erfanden wir technische Medien wie die Schrift, um die komplexen Bezüge unserer Hirngespinste nicht zu verlieren. Inzwischen so daran gewöhnt, diese virtuellen Konstruktionen für unser Leben zu halten, bemerken wir nicht mehr, dass unsere singuläre Biografie im Fluss des kosmischen Lebens geringe Bedeutung hat.
Sinn
Sinn ist die Ordnungsform der sprachlich-virtuellen Dimension
Sinn kann nur im intersubjektiven Raum der sprachlich-virtuellen Dimension entstehen. Er wird vom sprachfähigen Menschen konstruiert, wie alles in der Sprache.
Im Sein der biologisch-physischen Dimension gibt es keinen Sinn! Dort gibt es nur das Driften der Evolution im Kontinuum der materiellen Genese.
Gefühle
Emotion und Gefühl, Antonio Damasio in "Looking for Spinoza", Seite 79ff.:
"Spinoza intuited that congenital neurobiological wisdom and encapsulated the intuition in his conatus statements, the notion that, of necessity, all living organisms endeavor to preserve themselves without conscious knowledge of the undertaking and without having decided, as individual selves, to undertake anything. In short, they do not know the problem they are trying to solve. When the consequences of such natural wisdom are mapped back in the central nervous system, subcortically and cortically, the result ist feelings, the foundational component of our minds.
Evolution appears to have assembled the brain machinery of emotion and feeling in installments. First came the machinery for producing reactions to an object or event, directed at the object or at the circumstances - the machinery of emotion. Second came the machinery for producing a brain map and then a mental image, an idea, for the reactions and for the resulting state of the organism - the machinery of feeling.
Feeling, in the pure and narrow sense of the word, was the idea of the body in a certain way."
Die Unterscheidung, die Antonio Damasio zwischen Emotionen und Gefühlen formuliert, ist genial. Emotionen wären danach - in der Dimension des Seins - während der Entstehung und Entwicklung von Leben biologisch kodierte Verhaltensprogramme, mit denen die Evolution das Überleben ihrer Geschöpfe organisiert. Gefühle dagegen wären - in der Dimension der Sprache - die symbolische Repräsentation dieser Emotionen, d.h. mittels der Sprache formulierte Interpretationen und Deutungen der Körperzustände, die sie hervorbringen.
Mit dem Begriff Emotionen verweisen wir Menschen somit mittels Sprache auf den von unserer Spezies bei allen Lebewesen beobachteten körperlichen Vorgang und dessen Bedeutung, den er im Zusammenspiel bzw. der Verhaltenskoordination der Kreaturen einnimmt. Emotionen treten folglich bei allen lebenden Geschöpfen auf, regeln deren Verhalten untereinander und in ihrer sonstigen Umwelt. Mangels Sprache sind sich alle nichtsprachlichen Wesen jedoch dessen, was wir als Emotionen bezeichnen, nicht bewusst. Sie verhalten sich einfach so, wie es ihnen ihre spezifische phylogenetische und darauf aufbauende ontogenetische Lebensentfaltung bestimmt, ohne dies in einer symbolischen Form zu reflektieren.
Ein Wesen, dem die symbolische Repräsentation durch Sprache fehlt, "fühlt" deshalb nur aus der Beobachterperspektive der sprachlich-virtuellen Dimension des Menschen, die aber nur dem Menschen selbst zugänglich ist. Jeder anderen Spezies bleibt diese Art der Reflexion und Interpretation seiner natürlichen Verhaltenssteuerung, die wir in der Sprache Emotionen nennen, verschlossen. Sie haben keine Ahnung davon, was wir ihnen alles an Gefühlen zuschreiben.
Wir dürfen nicht das biologisch-physische Phänomen mit dessen sprachlich-virtueller Repräsentation verwechseln, das nur uns Menschen, jedoch keinesfalls den nichtsprachlichen Wesen zugänglich ist.
Weshalb ist dann aber die sprachlich-begriffliche Unterscheidung in Emotionen und Gefühle sowie deren Interpretation durch Damasio so interessant? Dazu nochmals ein Zitat aus seinem Buch "Looking for Spinoza", Seite 28:
"Emotions play out in the theater of the body. Feelings play out in the theater of the mind."
Wir nähern uns der Problematik Körper und Geist, die uns ab jetzt begleiten wird. Damasios Unterscheidung ist der Schlüssel zur "körperlichen" Basis des menschlichen Geistes. Dadurch wird die physisch-neuronale, körperliche Verortung des Geistes in unseren menschlichen Gehirnen möglich, ohne die offensichtliche Virtualität seiner sprachlichen Erscheinungsform einzuschränken.
Aber dazu erst weiter unten mehr. Wir benötigen noch ein paar weitere Mosaiksteine, um uns die sprachlich-virtuelle Dimension unserer Existenz zu erschließen.